Chronik der Naturschutzarbeit (Band I)
- Text
- Pflanzen
- Tiere
- Lebensraum
- Chronik
- Naturschutzarbeit
- Naturschutz
- Landkreis
Naturschutzarbeit im Landkreis Löbau-Zittau
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • Anfänge • • • • • • • des • • Naturschutzes • • • • • • • • • • • bis • • 1945 • • • • • • • • Peter Buschmann: Der Pflanzgarten Gründung – Entwicklung – Gegenwart … Als 1912 der Ebersbacher Humboldtverein auf dem Schlechteberg ein Museum mit Gaststätte und Vereinszimmer errichten ließ, fiel der Vorschlag zur Einrichtung eines Gartens mit bunter Pflanzendecke auf fruchtbaren Boden. Der Gutsbesitzer Julius Schulze, genannt Schulze-Bauer, hatte nach den Dienstjahren als Förster im Kaukasus in seinem Garten an der jetzigen Mozartstraße ein Alpinum von seltener Schönheit eingerichtet. Nach diesem Modell sollte am Nordhang des Schlechteberges, unterhalb der neuen Baude, ein Alpengarten entstehen. Schon beim Ausheben der Baugrube für die Baude wurden die Erdmassen zur Gestaltung der späteren Anlage in drei Terrassen eingebaut. Als Mitglied des Bauausschusses hielt Julius Schulze ein wachsames Auge auf die Profilierung der Außenanlagen. Als am 1. September 1912 die Humboldtbaude feierlich eingeweiht wurde, war die oberste Terrasse schon ein Blütenteppich. Schulze-Bauer hatte mehrere Wagenladungen Heidekraut auf den Schlechteberg gebracht und ausgepflanzt. Noch im Herbst 1912 wurde auf dem Gelände des Humboldtvereins zwischen den Terrassen der Rasen abgestochen und für die spätere Anlage der Pflanzenquartiere auf Haufen gesetzt. Julius Schulze und der Vorsitzende des Vereins, Herrmann Andert, beaufsichtigten diese Arbeiten, welche von bezahlten Kräften durchgeführt wurden … (Quelle: Rund um den Schlechteberg – aus Vergangenheit und Gegenwart. Einblicke in die Ebersbacher Chronik, Heft 2) (Quelle: Wanderversammlung des Verbandes „Lusatia“ zu Ebersbach 1912. Den Versammlungsteilnehmern gewidmet vom Humboldtverein Ebersbach.) 11
Auszug der Ansprache von Alexander Wünsche zum 100-jährigen Bestehen des Naturschutzgebietes „Rotstein“ 2012 … Das Naturschutzgebiet Rotstein ist heute eine Perle in der Kette von 212 Naturschutzgebieten Sachsens. Mit einer Größe von heute reichlich 81 Hektar ist das Gebiet jedoch eher klein. Der Sächsische Durchschnitt liegt dank der großen Naturschutzgebiete wie Königsbrücker Heide, Niederspree und der Schutzzonen des Biosphärenreservates bei 245 Hektar. Als eines der ersten Naturschutzgebiete hat es heute jedoch einen ganz besonderen Wert, weil sich in ihm nicht nur 100 Jahre Entwicklung eines Naturschutzgebietes ablesen lassen, sondern weil sich auch der vielfältige Wandel unserer Landschaft und unseres Verhältnisses zur Natur verfolgen lassen. Als die Königliche Amtshauptmannschaft Löbau am 26. März 1912 bekannt gab, dass in allen Wald bestandenen Teilen des Rotsteins das Abpflücken und Ausgraben von Pflanzen und Pflanzenteilen sowie das Verlassen der Touristenwege verboten wird, war damit eines der ersten Naturschutzgebiete in Sachsen geboren. Nur sehr wenige sind älter – wie z. B. die Kuppe des Wachtelberges bei Wurzen mit ihrem Kuhschellenvorkommen . Zur Festsetzung kam es, weil Amthauptmannschaft Löbau, Humboldtverein Löbau, Landesverein Sächsischer Heimatschutz und einige Waldbesitzer in gemeinsamer Absicht die hervorragende Pflanzenwelt vor allzu eifrigen Kräutersammlern schützen wollten. Besonders die üppigen Leberblümchenteppiche und die seltenen Orchideen sind manchen Spaziergängern, „Kräuterweibchen“ und eifrigen botanisierenden Oberschülern zum Opfer gefallen. Damit nun im „Naturschutzbezirk“ des Rotsteins diese Verbote eingehalten werden, wurden „Rotsteinpfleger“ eingesetzt. In regelmäßigen Sitzungen der Rotsteinpfleger mit der Amtshauptmannschaft Löbau, des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz und einiger Waldbesitzer wurde stetig am wirksamen Schutz des Rotsteins gearbeitet. Überhaupt ist es dem Landesverein Sächsischer Heimatschutz erst 1910 übertragen worden, eine eigene Abteilung für Naturschutz zu bilden und den sächsischen Stadträten und Amtshauptmannschaften als Fachberatung zur Seite zu stehen. Schon am 13. Februar 1911 legte der Landesverein dem Innenministerium eine Vorschlagsliste von Gebieten vor, die der Unterschutzstellung bedürfen. Diese Liste enthielt auch den Rotstein. Damals – wie heute – war es wichtig die Waldbesitzer für die Naturschutzgedanken zu begeistern. Besonders die Stadt Löbau hat als Waldbesitzer Vorbildliches geleistet. Als Selbstbeschränkung und ohne verordnete Verpflichtung kam man überein, die Bestockung auf dem Gipfel und den Trümmerhalden – wenn überhaupt – nur im Plenterbetrieb (also der Entnahme nur einzelner Bäume) zu nutzen. Auch sollten entlang der Kammlinie mehrere Reihen Laubbäume bei Neupflanzungen in Nadelbaumflächen gepflanzt werden. Das ist insofern bemerkenswert, da zu dieser Zeit die Nadelholzorientierung noch nahezu unanfechtbares wirtschaftliches Ziel der sächsischen Kahlschlagswirtschaft war. Die erste umfangreichere Nonnenkalamität schickte in dieser Zeit ihre Vorboten im Klosterwald Marienthal und im Zittauer Gebirge voraus. Ideen zur Abänderung der Waldbaustrategien folgten jedoch erst später als auch in Folge der großen Nonnenkalamitäten der 1920er Jahre der Forstmann Alfred Möller den Dauerwaldgedanken publik machte. Neben der Stadt Löbau haben sich auch die privaten Waldbesitzer dazu verpflichtet, bei ihrer Bewirtschaftung auf die wertvollsten Teile der Flora, nämlich die Eiben und den Wacholder, Rücksicht zu nehmen. Auf dieses Fundament gegründet, konnte sich das Naturschutzgebiet langfristig entwickeln. 12
- Seite 1 und 2: Bearbeitung: Naturschutzzentrum„Z
- Seite 3 und 4: Kontakt Landratsamt Görlitz SG Unt
- Seite 5 und 6: 10 Zuhause im Landkreis Görlitz 12
- Seite 7 und 8: 4
- Seite 9 und 10: Der Landkreis Löbau-Zittau Der Lan
- Seite 11 und 12: 8
- Seite 13: 1730 Forst- und Jagdordnung der Sec
- Seite 17 und 18: 1922 Gründung des Internationalen
- Seite 19 und 20: Die Naturwissenschaftliche Gesellsc
- Seite 21 und 22: 18 Werner Andert am Schlechteberg.
- Seite 23 und 24: lungsteile an verschiedenen Standor
- Seite 25 und 26: 22 Foto: Dietmar Spittler
- Seite 27 und 28: 1950 Neufestlegung der vorhandenen
- Seite 29 und 30: Nach 1949 kam es zur Bildung von Fa
- Seite 31 und 32: 28 Landschaftspflegeeinsatz Arbeits
- Seite 33 und 34: Haase: Zehn Jahre Kulturbund Auszug
- Seite 35 und 36: NSG Hengstberg Im NSG Hengstberg, F
- Seite 37 und 38: Aus der Arbeit der „Station Junge
- Seite 39 und 40: 1959 Horstwand an der Nordwand des
- Seite 41 und 42: 1960 „Jonsdorfer Felsenstadt“ e
- Seite 43 und 44: Die Jonsdorfer Mühlsteinbrüche Im
- Seite 45 und 46: 1962 Kulturspiegel für den Kreis L
- Seite 47 und 48: 1967 „Jonsdorfer Felsenstadt“ u
- Seite 49 und 50: 46 1969 Auszeichnung der Naturschut
- Seite 51 und 52: 1976 Bericht zur Entwicklung des Na
- Seite 53 und 54: 1970 Auszeichnung Naturschutzbeauft
- Seite 55 und 56: 52
- Seite 57 und 58: 1974 Erklärung von Landschaftsteil
- Seite 59 und 60: Interview mit einem Zeitzeugen Gün
- Seite 61 und 62: mentiert. Das lag mir nicht so. Ich
- Seite 63 und 64: Persönlicher Antrag des Kreisnatur
- Seite 65 und 66:
Konzeption zur Wiederaufforstung de
- Seite 67 und 68:
1983 Aufhebung der Schutzerklärung
- Seite 69 und 70:
Sächsische Zeitung v. 3.4.1987 Die
- Seite 71 und 72:
68
- Seite 73 und 74:
1987 Betreuungs-Pflegevertrag mit H
- Seite 75 und 76:
1988 Vertrag v. 21.9.1988: Rat des
- Seite 77 und 78:
Damit unsere Heimat blühe und gede
- Seite 79 und 80:
1988 Naturschutzhelfer-Aktivität O
- Seite 81 und 82:
78
- Seite 83 und 84:
1989 Antrag vom 30.1.1989 von S. H
- Seite 85 und 86:
1989 Einstweilige Sicherung zum Sch
- Seite 87 und 88:
84 1989 Ab 1.12.1989 ist als neuer
- Seite 89 und 90:
86 Renaturierung von Fließgewässe
- Seite 91 und 92:
Befragung von Herrn Dr. Brösel, Um
- Seite 93 und 94:
90 Blick auf die Klunst 1932
- Seite 95 und 96:
Befragung Gerd Hummitzsch, langjäh
- Seite 97 und 98:
Auf einen Aufruf vom RP Dresden hin
- Seite 99 und 100:
Vortrag: „Naturschutz zwischen Tr
- Seite 101 und 102:
Ein äußerst angenehmer Kollege un
- Seite 103 und 104:
1994 Kreisreform Zusammenlegung der
- Seite 105 und 106:
102 Olbersdorfer See mit Althalde F
- Seite 107 und 108:
Naturschutzprojekte Landkreis Löba
- Seite 109 und 110:
Mandy Ciezynski Landkreis Journal.
- Seite 111 und 112:
Die sechs Naturschutzprojekte 1 Ren
- Seite 113 und 114:
Das Neophytenprojekt des Landkreise
- Seite 115 und 116:
112
- Seite 117 und 118:
Landkreis Journal Amtsblatt des Lan
- Seite 119 und 120:
116
- Seite 121 und 122:
turschutzbehörde eingestellt. Auch
- Seite 123 und 124:
Schulen finden, einen ausgezeichnet
- Seite 125 und 126:
122 Foto: NSZ
- Seite 127 und 128:
1905 von den Forstverwaltungen der
- Seite 129 und 130:
Horstschutzzonenbetreuung Schutzma
- Seite 131 und 132:
128 SZ Artikel aus dem Archiv der U
- Seite 133 und 134:
Projektbeispiel: Renaturierung eine
- Seite 135 und 136:
Beiträge mit Hinweisen zur Bestand
- Seite 137 und 138:
134
- Seite 139 und 140:
Haselmaus (Muscardinus avellanarius
- Seite 141 und 142:
Im Gespräch mit Herrn Wolfram Poic
- Seite 143 und 144:
140 Pflege der Silberdistelflächen
- Seite 145 und 146:
Breitblättriges Knabenkraut (Dacty
- Seite 147 und 148:
144 Rotsteinverein e.V., Foto: Wilf
- Seite 149 und 150:
Der Rotsteinverein e.V. in Sohland
- Seite 151 und 152:
148 Quelle: Zeitungsartikel aus dem
- Seite 153 und 154:
auch die Gelege der Schellenten bli
- Seite 155 und 156:
Andreas Jedzig, Vorsitzender des NA
- Seite 157 und 158:
Schon eine langjährige Tradition:
- Seite 159 und 160:
Die Eichgrabener Teiche Südöstlic
- Seite 161 und 162:
Auf dem Bergwiesenfest, Fotos: Andy
- Seite 163 und 164:
Infotafel im Eingangsbereich des Sc
- Seite 165 und 166:
Im Gespräch mit Herrn Dietmar Böh
- Seite 167 und 168:
Zur Geschichte der Fachgruppe Ornit
- Seite 169 und 170:
Fachgruppe Ornithologie und Vogelsc
- Seite 171 und 172:
Arbeitseinsatz am Kaltbach Pflanzar
- Seite 173 und 174:
Arbeitseinsatz am Kaltbach Der Kalt
- Seite 175 und 176:
Nach einem Pflanzeinsatz Organisati
- Seite 177 und 178:
haben wir für unseren Ort neben Na
- Seite 179 und 180:
176 Revitalisierungsmaßnahmen am F
- Seite 181 und 182:
Neben eigenen praktischen Naturschu
- Seite 183 und 184:
* Das Forellenflössel wurde im Rah
- Seite 185 und 186:
Landschaft zu informieren und für
- Seite 187 und 188:
Anlage eines grenzübergreifenden d
- Seite 189 und 190:
Name Betreutes Gebiet Artbetreuer U
- Seite 191 und 192:
Name Betreutes Gebiet Artbetreuer S
- Seite 193 und 194:
Name Betreutes Gebiet Artbetreuer M
- Seite 195 und 196:
Name Betreutes Gebiet Artbetreuer I
- Seite 197 und 198:
Name Betreutes Gebiet Artbetreuer G
- Seite 199 und 200:
196
- Seite 201 und 202:
(26) Makatsch, W. (1950): Schafft N
- Seite 203 und 204:
(81) Schwanitz, G. (1968): Die „F
- Seite 205 und 206:
(131) Rat des Kreises Löbau, Abtei
- Seite 207 und 208:
(185) Rat des Kreises Zittau, Besch
- Seite 209 und 210:
(238) Dieckhoff, H.-P. (1994): Bota
- Seite 211 und 212:
Dank Wir bedanken uns ganz herzlich
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...

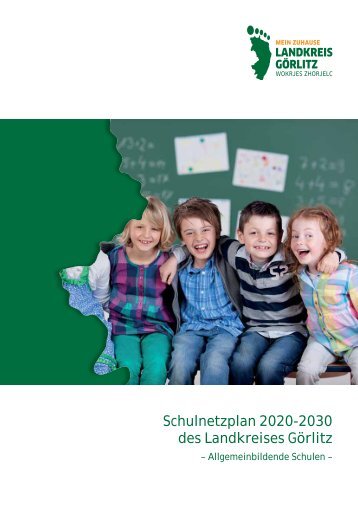

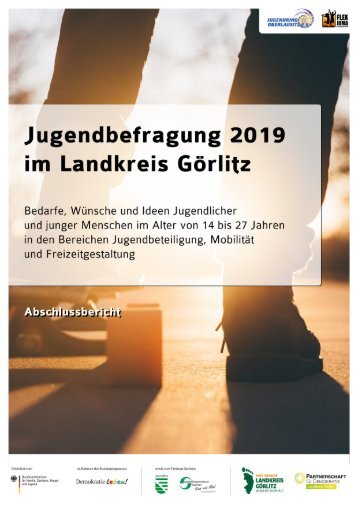
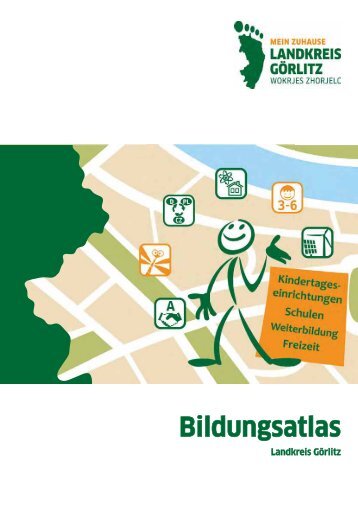
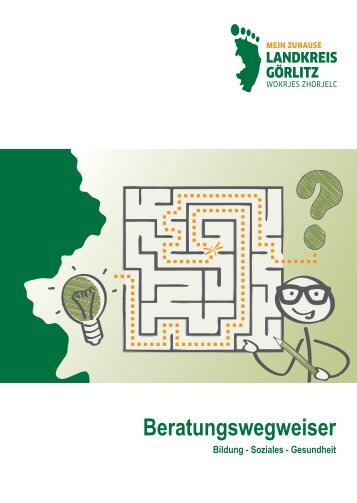

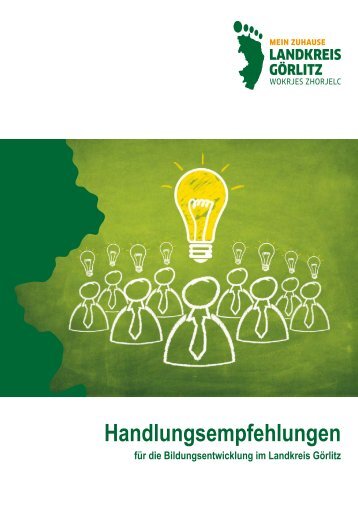
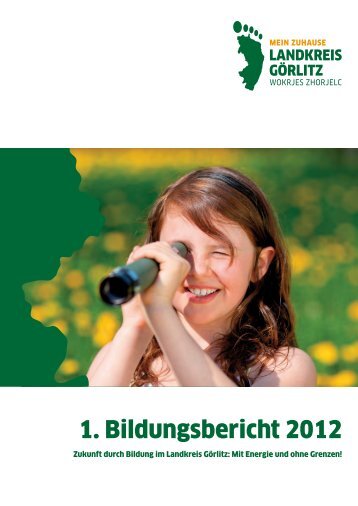
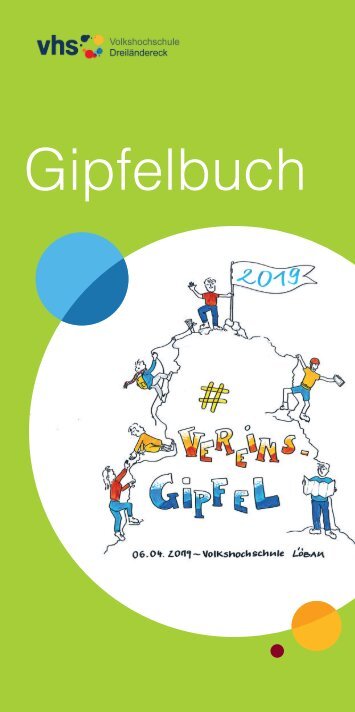
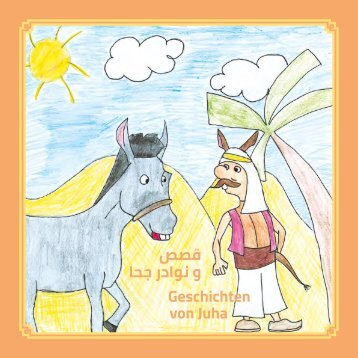





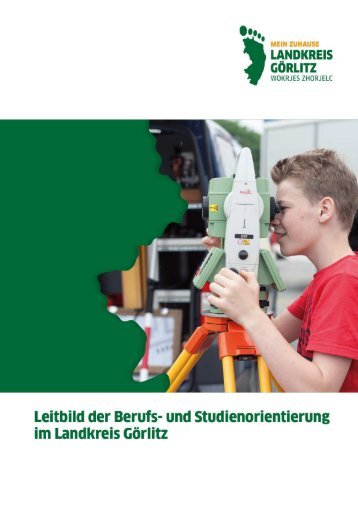
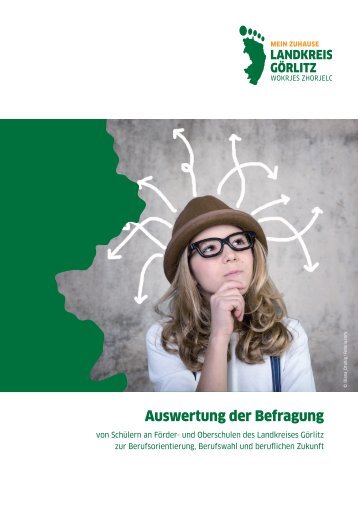




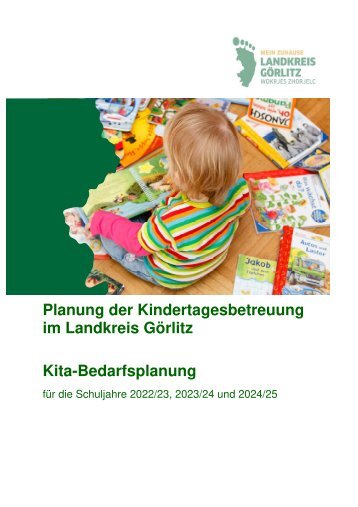
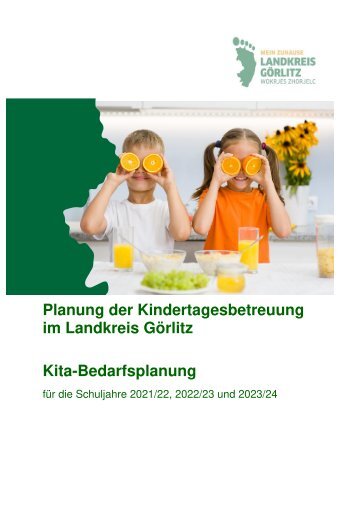
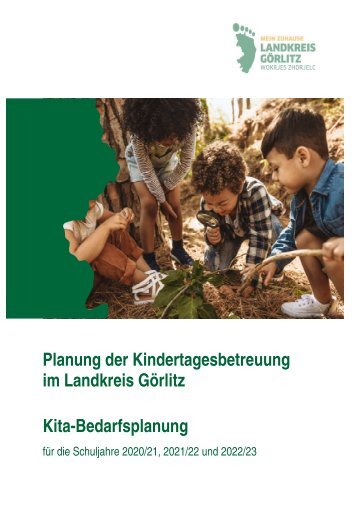

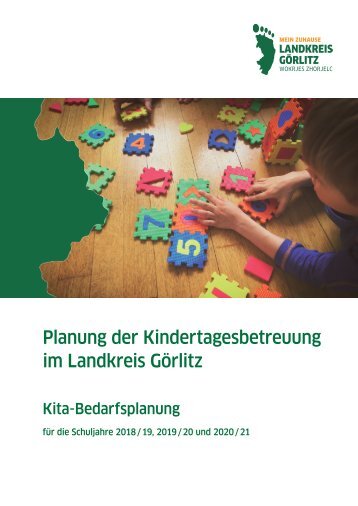


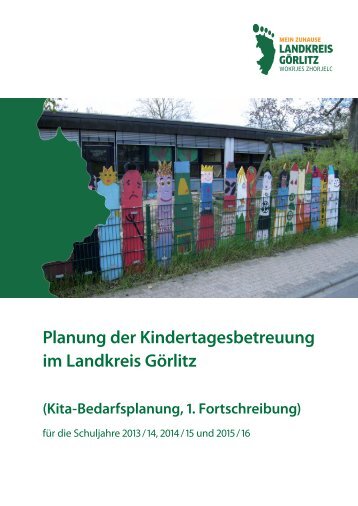



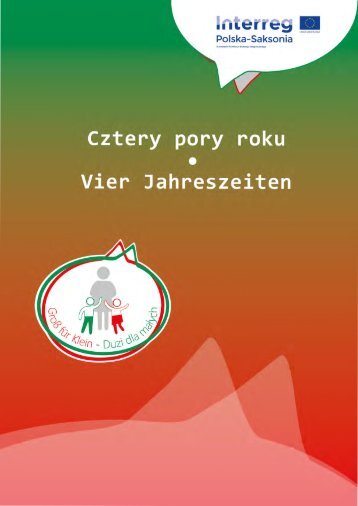
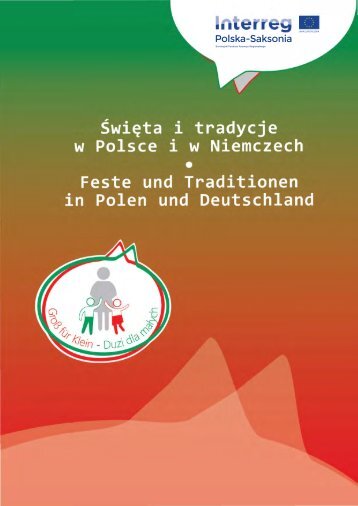
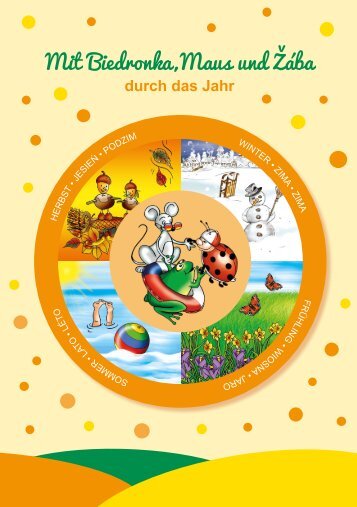


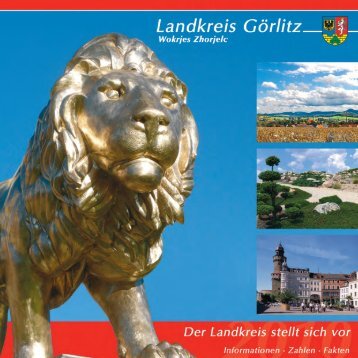






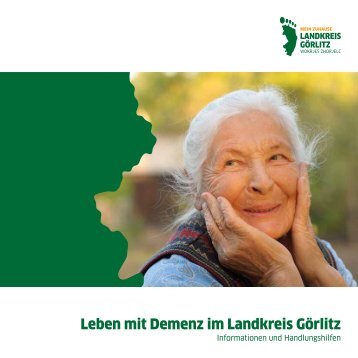


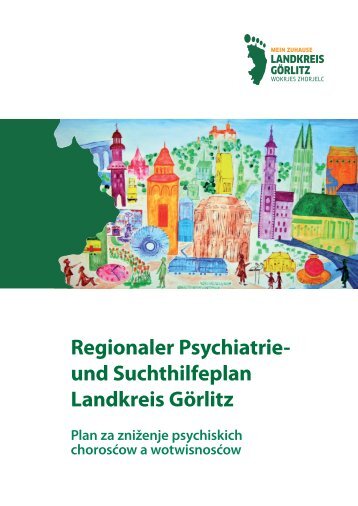
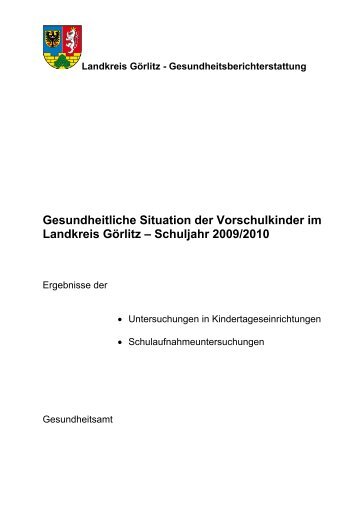
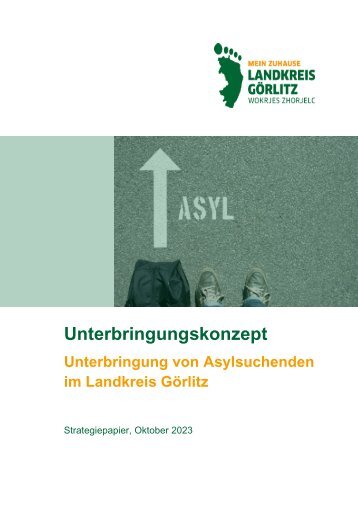




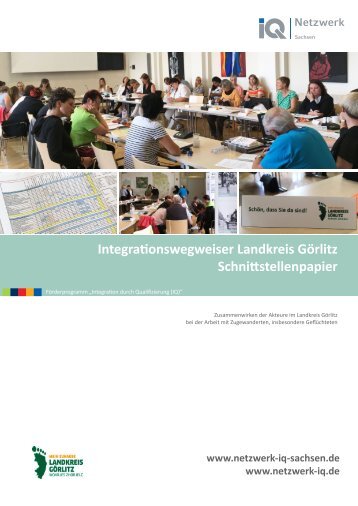
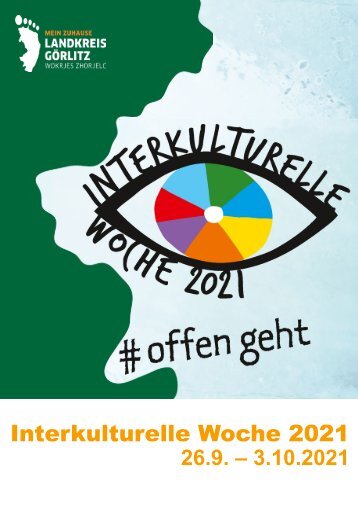
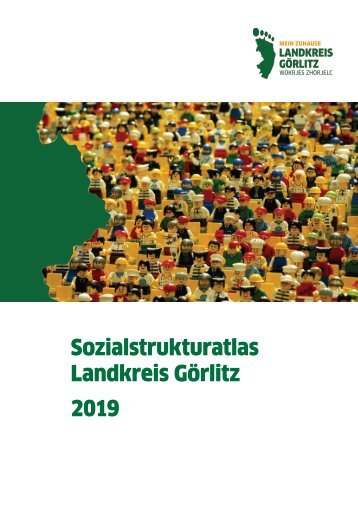
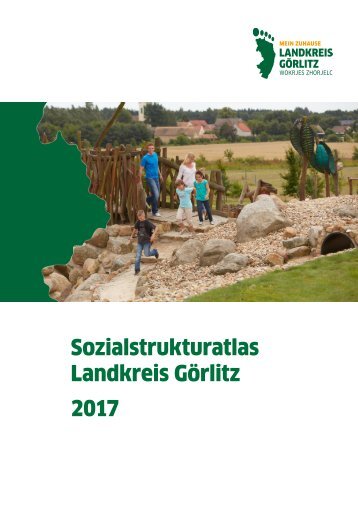
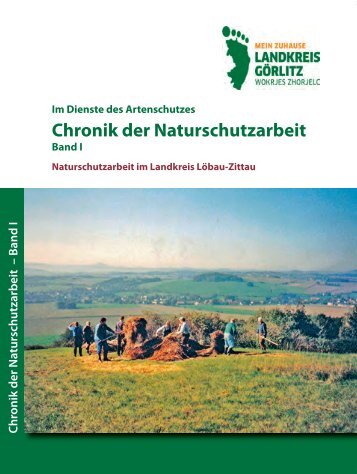
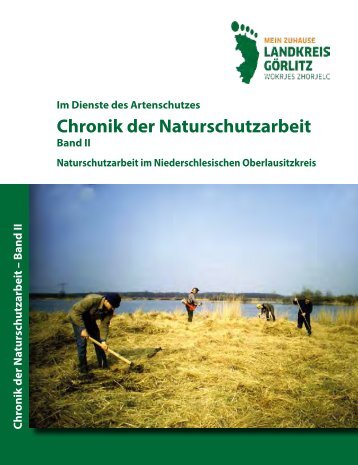
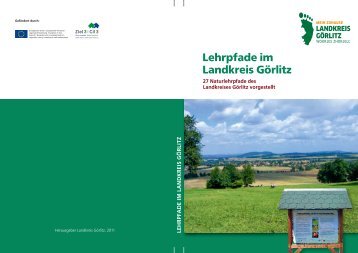
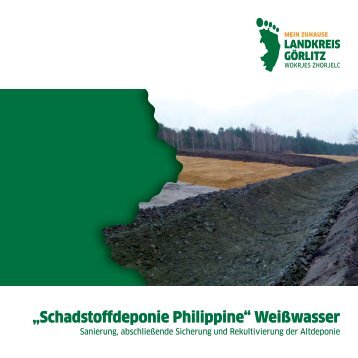



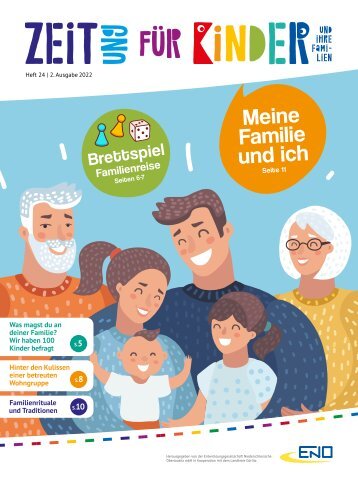



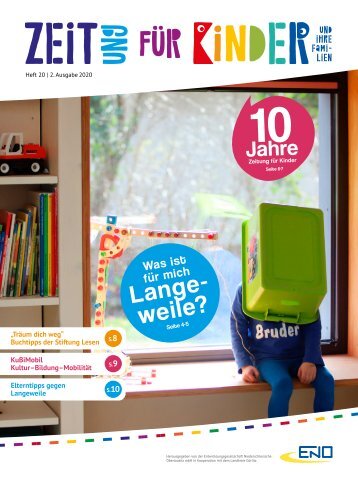


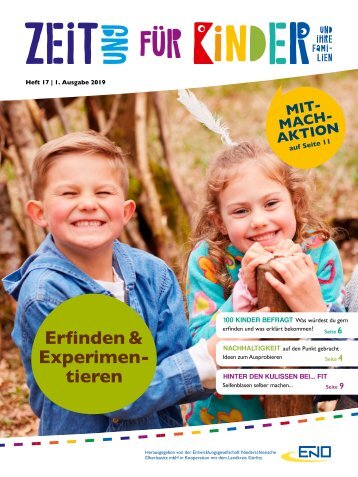
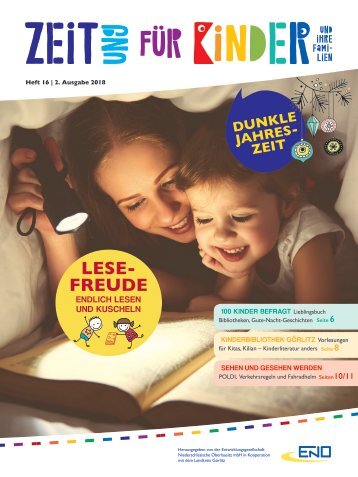
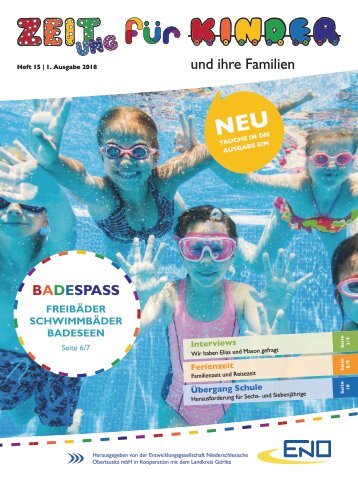

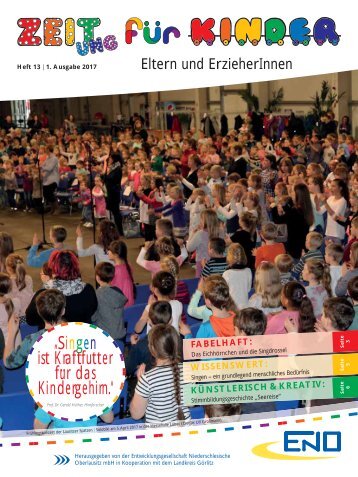
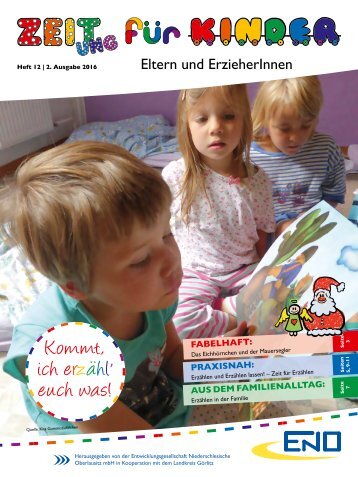
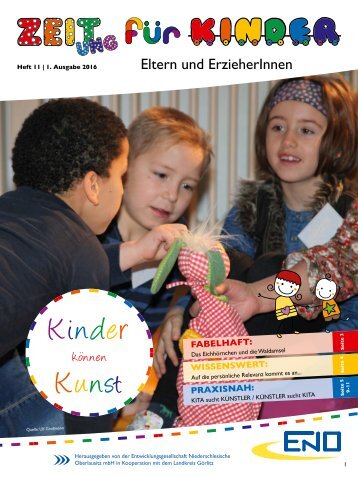
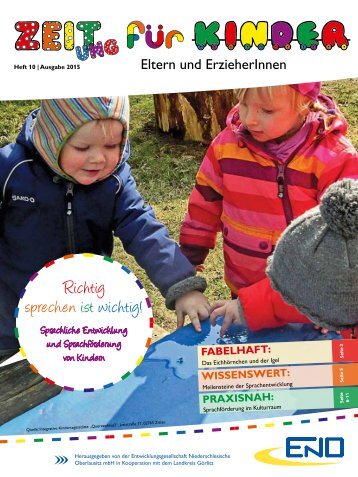

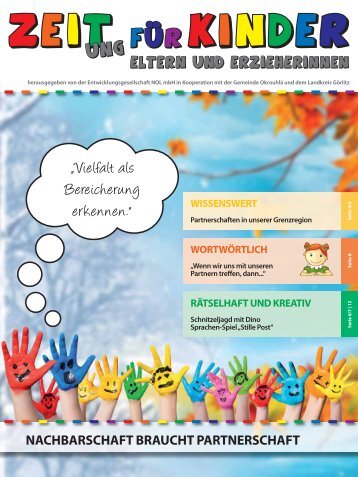



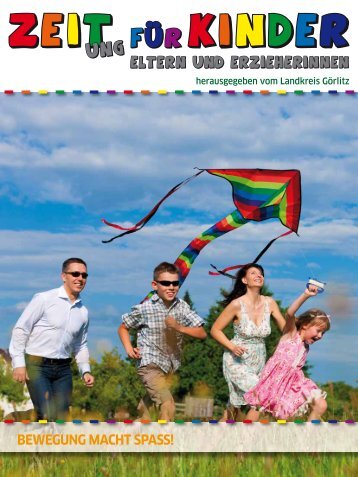
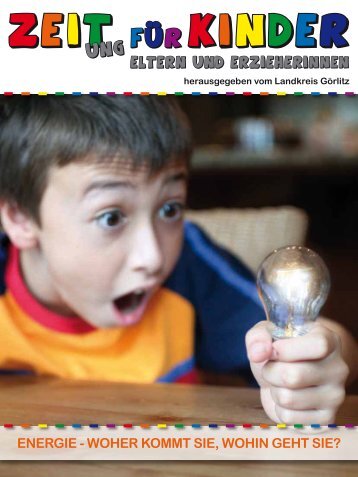


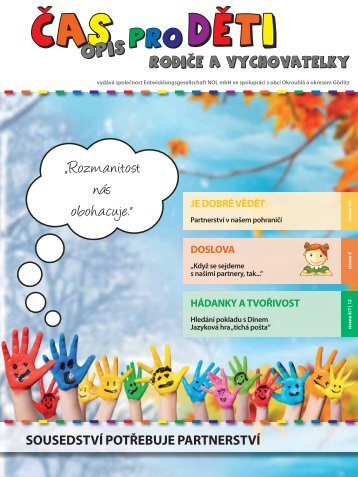



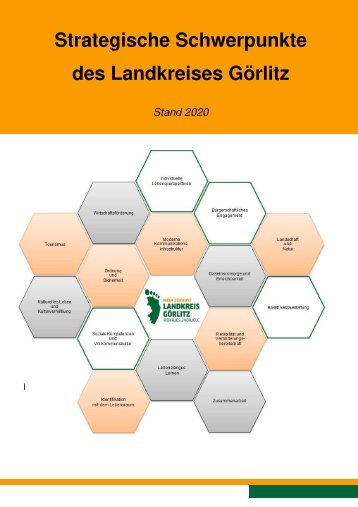
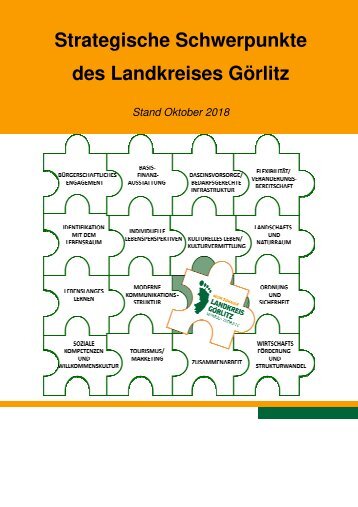
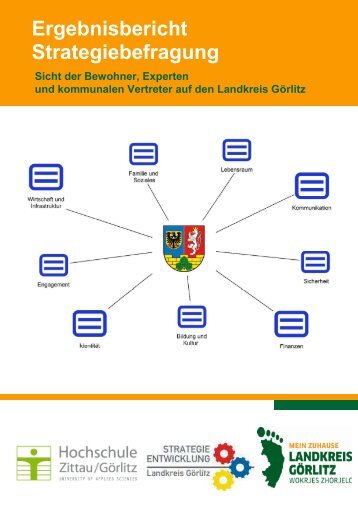
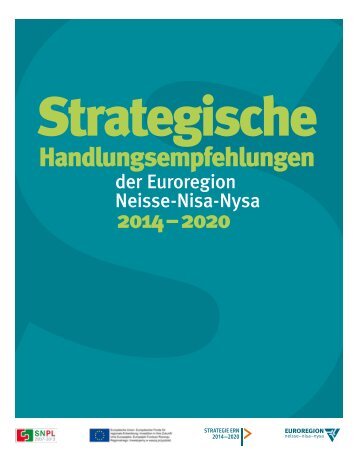




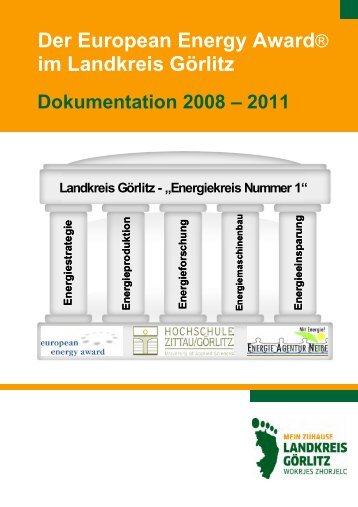
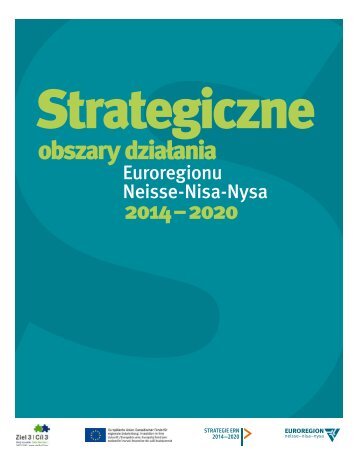

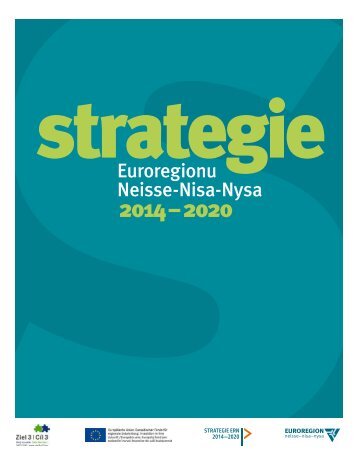

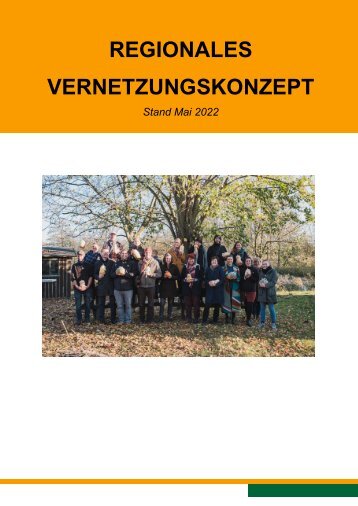
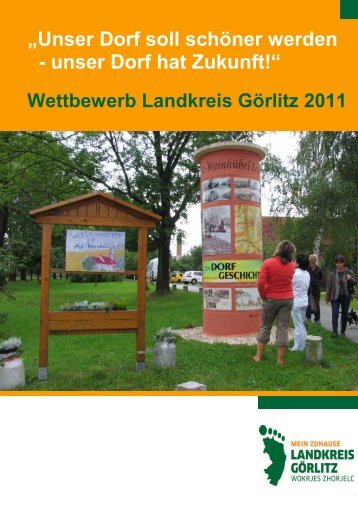
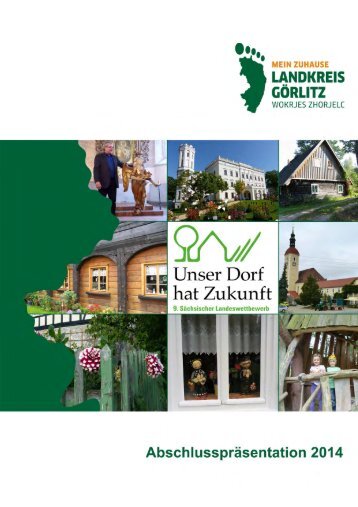



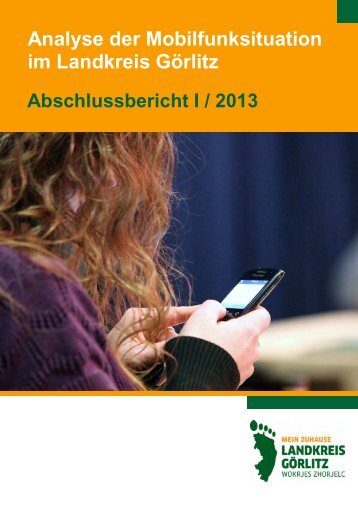

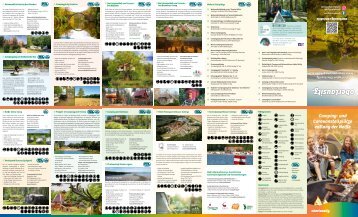
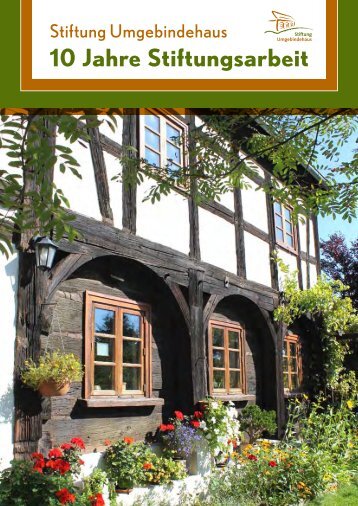
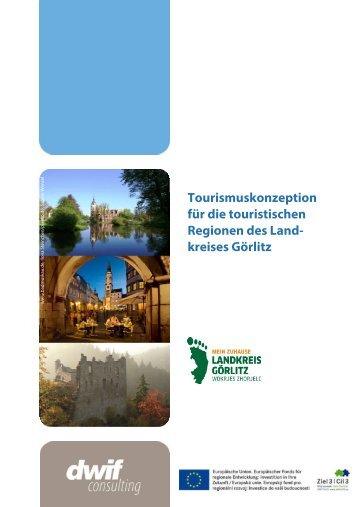


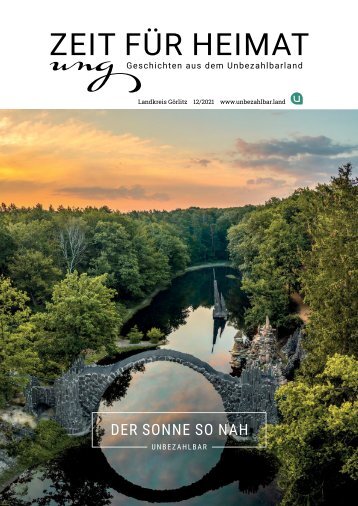
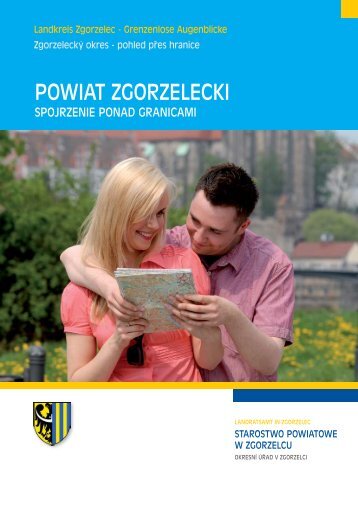
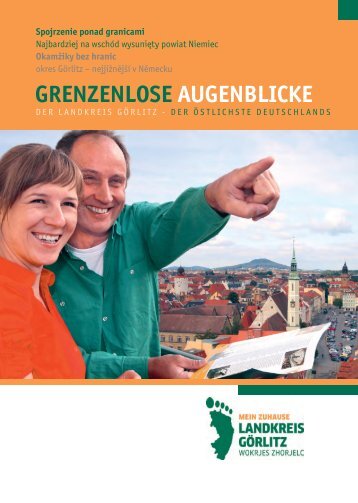
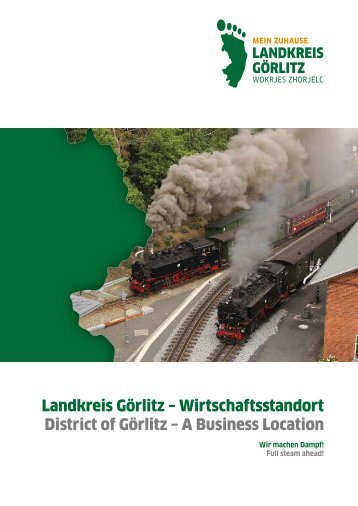

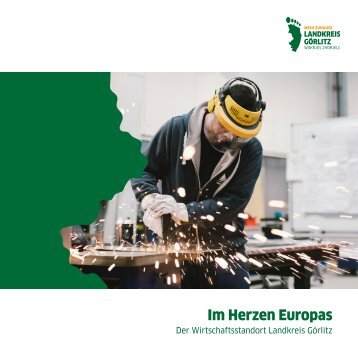

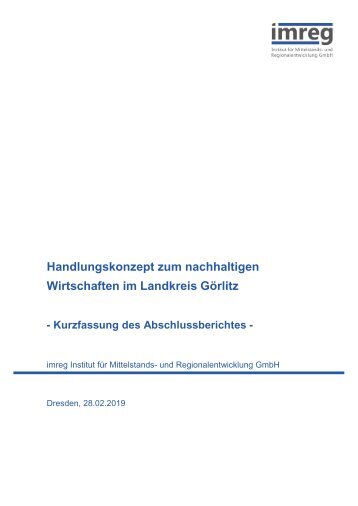
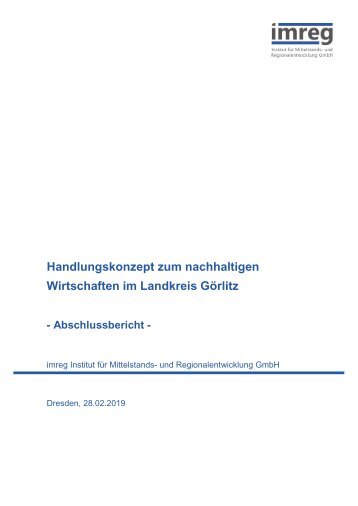
© Landkreis Görlitz 2023